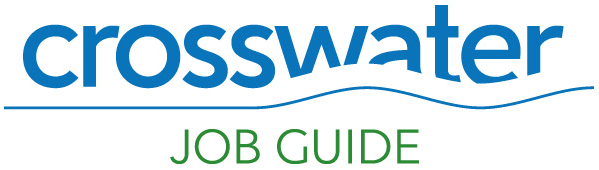Berufswahl: Tellerwäscher oder Millionär? Thomas Pikettys Weltformel

von Hans-Werner Sinn
Thomas Pikettys Weltformel*
Thomas Piketty hat mit seinem Buch über Verteilungsfragen den Nerv der Amerikaner getroffen. Das Buch erinnert an Karl Marx, Piketty hat einen ähnlich emotionalen Schreibstil, und er benutzt eine ähnliche Theorie.
Piketty führt die wachsende Ungleichheit auf die Formel r > g zurück, eine der wenigen Formeln, die es international in die Tageszeitungen geschafft hat und dort mittlerweile Einsteins Formel E=mc2 Konkurrenz macht. Die Formel besagt, dass der Zins im Sinne der durchschnittlichen Kapitalrendite (r) dauerhaft größer als die Wachstumsrate der Wirtschaft (g) ist. Die Folge sei, so Piketty, dass das Vermögen fortwährend schneller zunehme als die Wirtschaftsleistung. Marx hatte das schon mit seinem “Gesetz von der wachsenden organischen Zusammensetzung des Kapitals” behauptet. Überall diskutiert man heute Pikettys neue Weltformel.
Die Formel ist indes lange bekannt und kennzeichnet eine Grundannahme der Wachstumstheorie. In der Tat liegt der Zins längerfristig meistens über der Wachstumsrate, wie Piketty behauptet. Doch folgt daraus nicht, dass die Vermögen schneller wachsen als die Wirtschaftsleistung. Das wäre zwar so, wenn die Ersparnis der Volkswirtschaft mit den Zinseinkommen gleichgesetzt werden könnte, so dass der Zinssatz der Wachstumsrate der Vermögen gleicht. Das aber ist nicht der Fall.
Vielmehr ist die Ersparnis regelmäßig kleiner als die Summe aller Kapitalerträge. Insofern liegt die Wachstumsrate der Vermögen unter dem Zins, und der Umstand, dass der Zins die Wachstumsrate übersteigt, impliziert keinesfalls, dass die Vermögen schneller wachsen als die Wirtschaftsleistung.

Tatsächlich ist es ein zentrales Ergebnis der Wachstumstheorie, dass sich der Zins einer Volkswirtschaft in Abhängigkeit von der Sparquote langfristig gerade bei jenem Niveau einpegelt, bei dem die Wachstumsrate des Kapitals der Wachstumsrate der Einkommen entspricht. Die Konsequenz ist die langfristige Konstanz des Verhältnisses von Vermögen und Wirtschaftsleistung. Deutschlands prominenter Wachstumsforscher Ernst Helmstädter hatte dieses Ergebnis seinerzeit zum Kern seines Buches “Der Kapitalkoeffizient” gemacht: Der Kapitalkoeffizient ist genau die Relation von Vermögen und Einkommen, auf die Piketty abstellt.
Hinter der langfristigen Konstanz dieser Relation steht eine einfache mathematische Gesetzmäßigkeit. Wenn eine Volkswirtschaft einen bestimmten Anteil ihres Volkseinkommens spart, wächst das Vermögen, das ja durch die Akkumulation dieser Ersparnis gebildet wird, langfristig ebenfalls mit derselben Rate, mit der das Volkseinkommen wächst. Das Verhältnis von Vermögen und Einkommen kann also gar nicht dauerhaft ansteigen.
Die Gesetzmäßigkeit liegt darin begründet, dass eine jede wachsende Größe auf die Dauer nur mit der Rate wachsen kann, mit der auch ihr Zuwachs wächst. Man betrachte als Beispiel das Aufschütten eines Erdhaufens. Pro Periode wird ihm eine Schaufel Erde hinzugefügt, aber die Schaufel wird von Periode zu Periode um einen bestimmten Prozentsatz vergrößert. Dann konvergiert die prozentuale Wachstumsrate der Menge an Erde, die auf dem Haufen liegt, gegen die Wachstumsrate der Schaufelgröße. Setzt man die Menge an Erde auf der Schaufel mit der laufenden Ersparnis der Volkswirtschaft und die Größe des Erdhaufens mit dem Vermögen gleich, folgt die langfristige Konstanz der Relation von Vermögen und Einkommen, wenn aus dem Einkommen ein fester Anteil gespart wird.
Es ist aber zu betonen, dass es bei dieser Gesetzmäßigkeit um lange Fristen von einer Reihe von Jahrzehnten geht. Temporär kann das Vermögen sehr wohl schneller als das Volkseinkommen wachsen. Aber auch, wenn das der Fall ist, gibt es kaum Anlass für allzu große Befürchtungen, weil es für die Verteilungsfrage weniger auf das Verhältnis von Vermögen und Volkseinkommen als auf die Anteile am Volkseinkommen ankommt. Diese Anteile wiederum sind, das hat schon die linke Ökonomin Joan Robinson 1942 in ihrem Buch “An Essay on Marxian Economics” festgestellt, im Zeitablauf relativ konstant und folgen jedenfalls keinem Trend.
Viel wichtiger als Pikettys Weltenformel ist die Frage, wie viele Menschen sich die Lohn- und Kapitaleinkommen teilen. Wenn die Zahl der abhängig Beschäftigten schneller steigt als die Zahl der Vermögensbesitzer, könnte es trotz der Konstanz der Relation von Kapital- und Lohneinkommen zu unguten Entwicklungen in der Einkommensverteilung kommen. Das mag für Amerika, das viel Einwanderung verzeichnet hat, zutreffen und der tiefere Grund für die wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung sein. Aber es gibt keine Anhaltspunkte, dass es sich dabei um eine generelle Gesetzmäßigkeit handelt.
Und wenn wirklich die Gefahr besteht, dass die Zahl der Reichen im Verhältnis zur Zahl der Armen zu langsam wächst, ist die beste Medizin, dass man die Aufstiegschancen verbessert. Je mehr Tellerwäscher Millionäre werden, desto kleiner ist das Verteilungsproblem.
Auch hilft es, wenn die Reichen mehr Kinder als die Armen haben, denn durch die Teilung der Erbschaften würde sich das Verteilungsproblem von ganz allein lösen.
Dessen ungeachtet braucht man ein progressives Steuersystem, um den Zuwachs der Nettoeinkommen im oberen Bereich zu begrenzen. Denn auch wenn es keine Grundtendenz zu mehr Ungleichheit aufgrund der von Piketty formulierten Theorie gibt, kann die Ungleichheit innerhalb der Gruppe der Vermögensbesitzer zunehmen, weil einzelne Dynastien immer mehr Vermögen akkumulieren. Ob in Europa ein besonderer Handlungsbedarf besteht, lässt sich freilich bezweifeln, denn die Progression hat hier ja bereits erhebliche Ausmaße angenommen.
So bleibt das Urteil, dass Piketty wie Marx zwar eine Sehnsucht der Bevölkerung bedient – doch seine Politikempfehlungen mit einer Weltformel zu untermauern versucht, die nicht das impliziert, was er behauptet.
Hans-Werner Sinn
Professor für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft
Präsident des ifo Instituts
* Erschienen unter dem Titel “Thomas Pikettys Weltformel”, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Nr. 19, 11. Mai 2014, S. 29.